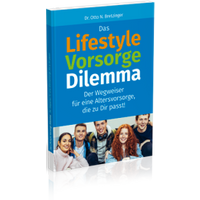Inhaltsverzeichnis:
Auswirkungen der Privatinsolvenz auf das Kind und die Familie
Privatinsolvenz bringt Unsicherheit ins Familienleben, besonders wenn ein Kind unterwegs ist oder gerade geboren wurde. Was viele nicht wissen: Die Insolvenz betrifft rechtlich nur das Vermögen und Einkommen der betroffenen Person. Das Kind selbst wird nicht automatisch in Mithaftung genommen. Dennoch spüren Familien die Folgen im Alltag deutlich – und zwar nicht nur finanziell.
Psychische Belastung und Familienklima
Die ständige Sorge um das Existenzminimum kann zu Spannungen führen. Kinder spüren diese Unsicherheit oft, auch wenn sie die Hintergründe nicht verstehen. Gespräche über Geld werden häufiger, Wünsche müssen öfter zurückgestellt werden. Das verändert das Familienklima – manchmal schleichend, manchmal sehr abrupt.
Weniger finanzielle Spielräume
Die finanziellen Möglichkeiten der Familie sind durch die Pfändungsfreigrenzen und das Insolvenzverfahren stark eingeschränkt. Große Anschaffungen, Urlaube oder besondere Freizeitaktivitäten sind oft nicht mehr drin. Das wirkt sich direkt auf die Teilhabe des Kindes am sozialen Leben aus – beispielsweise beim Thema Klassenfahrten oder Vereinsbeiträge.
Schutz des Kindesvermögens
Geld, das eindeutig dem Kind gehört (zum Beispiel Sparbücher auf den Namen des Kindes oder Geschenke von Verwandten), bleibt grundsätzlich außen vor. Aber: Die Eigentumsverhältnisse müssen klar und lückenlos nachweisbar sein. Fehlt dieser Nachweis, kann es im schlimmsten Fall zu Missverständnissen mit dem Insolvenzverwalter kommen.
Veränderungen im Alltag
Familien müssen lernen, mit weniger auszukommen. Das erfordert Kreativität und Flexibilität – etwa beim Einkaufen, bei Geburtstagsfeiern oder in der Freizeitgestaltung. Manche Eltern empfinden das als Belastung, andere sehen darin sogar eine Chance, neue Werte zu vermitteln und enger zusammenzurücken.
Fazit
Auch wenn das Kind rechtlich nicht für die Schulden haftet, sind die Auswirkungen der Privatinsolvenz auf das Familienleben spürbar. Wer vorbereitet ist und offen mit dem Thema umgeht, kann viele Stolpersteine vermeiden und die schwierige Zeit gemeinsam meistern.
Haftet mein Kind oder mein Ehepartner für meine Schulden in der Privatinsolvenz?
Direkte Haftung: Wann sind Ehepartner oder Kinder betroffen?
In der Privatinsolvenz gilt: Nur wer selbst einen Vertrag unterschrieben oder ausdrücklich für Schulden gebürgt hat, kann auch zur Kasse gebeten werden. Ihr Ehepartner oder Ihr Kind haften also grundsätzlich nicht für Ihre Verbindlichkeiten. Das klingt erstmal beruhigend, oder?
- Bürgschaft oder Mitunterzeichnung: Hat Ihr Ehepartner einen Kreditvertrag gemeinsam mit Ihnen abgeschlossen oder als Bürge unterschrieben, dann kann die Bank ihn unabhängig von Ihrer Insolvenz in Anspruch nehmen. Kinder werden in der Praxis jedoch so gut wie nie als Vertragspartner eingesetzt.
- Steuerschulden bei gemeinsamer Veranlagung: Bei einer gemeinsamen Steuererklärung kann das Finanzamt auch den Ehepartner für Steuerschulden haftbar machen. Hier gilt die sogenannte Gesamtschuldnerschaft. Kinder sind hiervon nie betroffen.
- Verfahrenskosten: Nur in sehr seltenen Fällen – etwa wenn der Ehepartner eigenes pfändbares Einkommen hat und Sie gemeinsam wirtschaften – kann er für bestimmte Kosten des Insolvenzverfahrens herangezogen werden. Eine generelle Haftung besteht aber nicht.
Wichtig zu wissen: Vermögenswerte, die nachweislich Ihrem Ehepartner oder Kind gehören, sind geschützt. Es ist jedoch ratsam, Eigentumsverhältnisse klar zu dokumentieren, um Missverständnisse mit dem Insolvenzverwalter zu vermeiden.
Zusammengefasst: Ihr Kind haftet nie für Ihre Schulden, Ihr Ehepartner nur in klar definierten Ausnahmefällen. Wer sich unsicher ist, sollte frühzeitig fachlichen Rat einholen, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden.
Vor- und Nachteile einer Privatinsolvenz während der Familiengründung
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Kind und Ehepartner haften in der Regel nicht für die Schulden | Finanzielle Spielräume der Familie sind stark eingeschränkt |
| Kindergeld bleibt vollständig geschützt und kann nicht gepfändet werden | Teilnahme des Kindes am sozialen Leben (z. B. Klassenfahrten) kann erschwert werden |
| Erhöhter Pfändungsfreibetrag mit Kind sichert das Existenzminimum besser ab | Psychische Belastungen und Spannungen können zunehmen |
| Vermögen, das nachweislich dem Kind gehört, bleibt außen vor | Strenge Nachweispflichten für unpfändbare Beträge und Unterhalt |
| Bei Elternzeit und Kinderbetreuung werden Erwerbsobliegenheiten individuell geprüft | Fehler bei Nachweisen oder beim P-Konto können zu finanziellen Nachteilen führen |
| Klare Vorbereitung (z. B. eigenes Konto fürs Kind) schützt Vermögenswerte | Kreativität und Flexibilität im Alltag notwendig, um Einschnitte auszugleichen |
Kindergeld in der Privatinsolvenz: Was bleibt geschützt?
Kindergeld bleibt auch während der Privatinsolvenz vollständig geschützt. Es handelt sich dabei rechtlich nicht um Einkommen des insolventen Elternteils, sondern steht ausschließlich dem Kind zu. Der Insolvenzverwalter darf Kindergeld weder pfänden noch für die Schuldentilgung heranziehen.
- Kindergeld auf dem eigenen Konto: Geht das Kindergeld auf ein Konto des Schuldners ein, sollte es klar als solche Zahlung erkennbar sein. Nur so kann es im Fall einer Kontopfändung eindeutig als unpfändbar ausgewiesen werden.
- Nachweisführung: Es empfiehlt sich, die Zahlungseingänge des Kindergeldes zu dokumentieren. Kontoauszüge, auf denen das Kindergeld separat aufgeführt ist, reichen in der Regel aus. Im Zweifel kann eine Bescheinigung der Familienkasse helfen.
- P-Konto und Freibetrag: Wer ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) nutzt, sollte der Bank die Kindergeldzahlungen nachweisen. Nur dann wird der Freibetrag um den entsprechenden Betrag erhöht und das Kindergeld bleibt unangetastet.
- Keine Anrechnung auf die Insolvenzmasse: Kindergeld zählt nicht zur Insolvenzmasse und darf weder zur Tilgung von Schulden noch zur Deckung von Verfahrenskosten verwendet werden.
Fazit: Solange Kindergeldzahlungen transparent und nachweisbar sind, bleibt dieses Geld dem Kind sicher. Eltern in der Privatinsolvenz sollten deshalb besonders auf eine saubere Trennung und Dokumentation achten.
Privatinsolvenz und Erwerbsobliegenheit bei Elternzeit oder Kinderbetreuung
Elternzeit und Kinderbetreuung können die Erwerbsobliegenheit in der Privatinsolvenz deutlich beeinflussen. Wer sich um ein Kind kümmert, muss nicht automatisch jede zumutbare Arbeit annehmen. Das Gericht prüft im Einzelfall, wie viel Erwerbstätigkeit tatsächlich verlangt werden kann. Hier kommt es auf Details an: Alter des Kindes, Betreuungsbedarf, familiäre Unterstützung und individuelle Lebensumstände spielen eine entscheidende Rolle.
- Alleinerziehende haben meist größere Chancen, ganz oder teilweise von der Erwerbsobliegenheit befreit zu werden. Gerade bei fehlender Fremdbetreuung oder langen Wartelisten für Kita-Plätze kann eine Erwerbstätigkeit schlichtweg unmöglich sein.
- Teilzeit-Modelle werden häufig als Kompromiss betrachtet, wenn das Kind älter ist oder Betreuungsangebote vorhanden sind. Wer sich nicht aktiv um eine zumutbare Beschäftigung bemüht, riskiert allerdings die Versagung der Restschuldbefreiung.
- Nachweispflicht: Es reicht nicht, die Betreuung nur zu behaupten. Eltern müssen belegen, warum und in welchem Umfang sie nicht arbeiten können – etwa durch Bescheinigungen vom Kindergarten, Nachweise über Betreuungszeiten oder ärztliche Atteste bei besonderen Belastungen.
- Flexible Lösungen sind möglich: In manchen Fällen akzeptieren Gerichte auch geringfügige Beschäftigungen oder Heimarbeit, wenn das mit der Kinderbetreuung vereinbar ist.
Wer unsicher ist, sollte frühzeitig rechtlichen Rat einholen, um keine Nachteile im Insolvenzverfahren zu riskieren.
Erhöhter Pfändungsfreibetrag mit Kind: Wie viel bleibt mir wirklich?
Mit Kind steigt der Pfändungsfreibetrag deutlich – das verschafft Eltern in der Privatinsolvenz spürbar mehr finanziellen Spielraum. Die Höhe richtet sich nach der Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen. Für jedes Kind, für das Sie tatsächlich Unterhalt leisten, erhöht sich der Freibetrag. Das bedeutet: Mehr Geld bleibt Ihnen monatlich zur Verfügung, um die Grundbedürfnisse Ihrer Familie zu sichern.
- Ab dem 1. Juli 2024 liegt der Grundfreibetrag bei 1.499,99 € pro Monat. Mit einem unterhaltsberechtigten Kind steigt dieser Betrag auf 2.059,99 €.
- Für zwei Kinder oder eine weitere unterhaltsberechtigte Person erhöht sich der Freibetrag auf 2.369,99 €.
- Je mehr Unterhaltsverpflichtungen bestehen, desto höher der Schutzbetrag – bei fünf unterhaltsberechtigten Personen sind es 3.309,99 € monatlich.
Entscheidend ist: Nur tatsächlich geleisteter Unterhalt zählt. Leben die Kinder im eigenen Haushalt, gilt der erhöhte Freibetrag automatisch. Bei getrennt lebenden Eltern muss der Unterhalt nachweisbar sein.
Ein Beispiel: Ein Elternteil mit einem Kind und einem Nettoeinkommen von 2.065 € muss nur 3,41 € monatlich abgeben – der Rest bleibt geschützt. Das Existenzminimum der Familie ist so gesichert, auch wenn das Einkommen schwankt oder sich die Familiensituation ändert.
Wer sich nicht sicher ist, wie hoch der individuelle Freibetrag ausfällt, kann auf die aktuelle Pfändungstabelle zurückgreifen oder sich beraten lassen. So bleibt garantiert kein Cent zu wenig zum Leben übrig.
Wichtige Nachweise und praktische Tipps für Eltern in der Privatinsolvenz
Nachweise sind das A und O, wenn Sie als Elternteil während der Privatinsolvenz besonderen Schutz beanspruchen möchten. Ohne lückenlose Dokumentation riskieren Sie, dass Freibeträge nicht anerkannt oder unpfändbare Beträge versehentlich abgeführt werden. Doch welche Unterlagen sind wirklich wichtig und was hilft Ihnen im Alltag weiter?
- Geburtsurkunde des Kindes: Sie dient als offizieller Nachweis für die Unterhaltspflicht und sollte immer griffbereit sein.
- Bescheinigungen über das Sorgerecht: Gerade bei getrennt lebenden Eltern oder Patchwork-Konstellationen kann ein Sorgerechtsnachweis entscheidend sein, um Ansprüche durchzusetzen.
- Nachweise über Unterhaltszahlungen: Kontoauszüge, Überweisungsbelege oder Jugendamtsbescheinigungen belegen, dass Sie tatsächlich Unterhalt leisten – ein Muss bei getrenntem Haushalt.
- Bestätigung der Kindergeldzahlung: Ein aktueller Nachweis der Familienkasse sorgt für Klarheit, falls das Kindergeld auf Ihr Konto fließt.
- Nachweise zur Betreuungssituation: Kitaplatz-Bescheinigungen, Betreuungszeiten oder Atteste belegen, warum eine Erwerbstätigkeit eingeschränkt oder unmöglich ist.
Praktische Tipps:
- Alle Nachweise immer aktuell halten – veraltete Unterlagen werden oft nicht akzeptiert.
- Dokumente digitalisieren und an einem sicheren Ort speichern, damit Sie sie bei Bedarf schnell vorlegen können.
- Bank und Insolvenzverwalter proaktiv informieren, sobald sich Ihre Familiensituation ändert (z. B. Geburt eines weiteren Kindes).
- Bei Unsicherheiten rechtzeitig fachlichen Rat einholen – Fehler bei Nachweisen führen schnell zu finanziellen Nachteilen.
Mit diesen Schritten behalten Sie den Überblick und sichern sich alle Vorteile, die Ihnen und Ihrem Kind in der Privatinsolvenz zustehen.
Beispiel: Privatinsolvenz mit einem Kind – Wie schützt sich eine junge Familie?
Ein praktisches Beispiel macht deutlich, wie eine junge Familie in der Privatinsolvenz gezielt vorgeht, um ihre Existenz zu sichern:
Anna und Tim erwarten ihr erstes Kind, als Tim in die Privatinsolvenz gerät. Sie möchten vermeiden, dass das Familienleben aus den Fugen gerät. Deshalb setzen sie auf eine vorausschauende Planung:
- Eigenes Konto für das Kind: Noch vor der Geburt richten sie ein Sparkonto auf den Namen des Kindes ein. Geldgeschenke von Verwandten landen direkt dort – so bleibt das Vermögen des Kindes klar getrennt und ist vor Zugriffen geschützt.
- Frühzeitige Anpassung des P-Kontos: Nach der Geburt beantragt Tim umgehend die Erhöhung des Freibetrags auf seinem Pfändungsschutzkonto. Die Geburtsurkunde reicht er direkt bei der Bank ein, damit das zusätzliche Existenzminimum für das Kind sofort berücksichtigt wird.
- Betreuung und Erwerbstätigkeit clever abstimmen: Anna nutzt die Elternzeit, Tim informiert das Insolvenzgericht über die neue Familiensituation. Er dokumentiert, wie die Kinderbetreuung seine Arbeitsmöglichkeiten beeinflusst, und legt Nachweise über Betreuungszeiten vor. So wird seine Erwerbsobliegenheit realistisch beurteilt.
- Offene Kommunikation mit dem Insolvenzverwalter: Das Paar hält den Insolvenzverwalter stets auf dem Laufenden – etwa bei Veränderungen der Betreuungssituation oder neuen Unterhaltsverpflichtungen. Das verhindert Missverständnisse und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.
- Regelmäßige Überprüfung der Freibeträge: Sie kontrollieren jährlich, ob die aktuellen Pfändungsfreigrenzen korrekt angewendet werden. Bei einer Erhöhung durch Gesetzesänderung informieren sie die Bank und lassen die Anpassung vornehmen.
Durch diese konkreten Schritte verschafft sich die junge Familie finanzielle Sicherheit und sorgt dafür, dass das Kind von der Insolvenz des Vaters nicht negativ betroffen wird.
Wie Sie Fehler vermeiden: Das P-Konto und die Bedeutung von Nachweisen
Fehler im Umgang mit dem P-Konto oder bei Nachweisen können in der Privatinsolvenz richtig teuer werden – und lassen sich mit ein paar gezielten Maßnahmen leicht vermeiden.
- P-Konto rechtzeitig einrichten: Wer sein Girokonto nicht rechtzeitig in ein Pfändungsschutzkonto umwandelt, riskiert, dass bei einer Kontopfändung das gesamte Guthaben blockiert wird. Die Umwandlung sollte also möglichst früh erfolgen, am besten schon bei absehbaren Zahlungsschwierigkeiten.
- Erhöhungen des Freibetrags aktiv beantragen: Die Bank passt den Freibetrag auf dem P-Konto nicht automatisch an, wenn sich die Familiensituation ändert. Nachweise wie Geburtsurkunden oder Unterhaltstitel müssen Sie selbst vorlegen, um den erhöhten Schutz zu erhalten.
- Regelmäßige Aktualisierung der Nachweise: Viele Banken und Insolvenzverwalter verlangen aktuelle Dokumente. Veraltete Nachweise werden oft nicht akzeptiert – besonders bei Unterhaltsverpflichtungen oder Änderungen im Familienstand.
- Guthabenüberträge vermeiden: Wird das Guthaben auf dem P-Konto über den Monatswechsel hinaus nicht genutzt, kann es im Folgemonat pfändbar werden. Daher ist es ratsam, das Konto regelmäßig auszugleichen.
- Unklare Zahlungseingänge vermeiden: Kommen Zahlungen (z.B. Kindergeld, Unterhalt) ohne eindeutigen Verwendungszweck aufs Konto, kann es zu Problemen bei der Freistellung kommen. Ein klarer Betreff hilft, den unpfändbaren Charakter nachzuweisen.
Mit diesen gezielten Schritten sichern Sie sich und Ihrer Familie den vollen Schutz des P-Kontos und vermeiden unnötige finanzielle Verluste durch formale Fehler.
Wann ist eine rechtliche Beratung im Einzelfall sinnvoll?
Eine rechtliche Beratung ist immer dann sinnvoll, wenn die eigene Situation von der typischen Konstellation abweicht oder Unsicherheiten bei der Auslegung von Gesetzen bestehen. Gerade bei komplexen Familienverhältnissen, etwa bei Patchwork-Familien, internationalen Unterhaltsfragen oder ungeklärten Eigentumsverhältnissen, kann ein Fachanwalt entscheidende Klarheit schaffen.
- Unklare Vermögensverhältnisse: Wenn Vermögen gemeinsam mit Dritten gehalten wird oder Schenkungen an Kinder oder Ehepartner erfolgt sind, kann anwaltliche Unterstützung helfen, spätere Rückforderungen oder Anfechtungen durch den Insolvenzverwalter zu vermeiden.
- Streit mit Gläubigern oder dem Insolvenzverwalter: Kommt es zu Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des pfändbaren Einkommens, die Anerkennung von Unterhaltsverpflichtungen oder die Auslegung von Nachweisen, ist professionelle Hilfe ratsam.
- Besondere Erwerbssituationen: Wer selbstständig ist, mehrere Einkommensquellen hat oder im Ausland arbeitet, profitiert von individueller Beratung, um Fehler bei der Berechnung des pfändbaren Betrags zu vermeiden.
- Verfahrensfehler oder drohende Versagung der Restschuldbefreiung: Bei drohenden Nachteilen im Verfahren, etwa durch Fristversäumnisse oder formale Fehler, kann ein spezialisierter Anwalt oft noch gegensteuern.
Eine frühzeitige, gezielte Beratung kann finanzielle Nachteile verhindern und sorgt für Sicherheit in einer ohnehin belastenden Lebensphase.
Nützliche Links zum Thema
- Erwerbsobliegenheit für Eltern mit Kind und während der Elternzeit
- Pfändungsfreibetrag mit Kind - Schuldnerberatung Schulz
- Privatinsolvenz während der Elternzeit: Alle wichtigen Infos
Produkte zum Artikel

9.95 EUR* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

59.95 EUR* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.
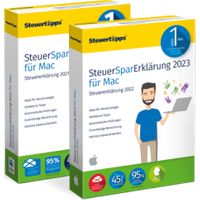
59.95 EUR* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

24.99 EUR* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.
Erfahrungen und Meinungen
Die ersten Monate nach der Geburt eines Kindes sind oft herausfordernd. Für Eltern in Privatinsolvenz wird diese Zeit zusätzlich belastend. Ein Nutzer berichtet, dass der Ex-Partner während seiner Insolvenz keinen Unterhalt zahlen kann. Das führt dazu, dass die finanzielle Unsicherheit wächst und die Lebensqualität der Familie leidet. Der Insolvenzverwalter kann nicht helfen, da der Ex-Partner selbständig ist und somit keine feste Einkommensquelle hat. Dies ist ein häufiges Problem in solchen Situationen. In Foren äußern viele Nutzer ähnliche Sorgen.
Ein weiteres häufiges Thema: die emotionalen Belastungen. Viele Eltern berichten, dass Kinder die finanzielle Unsicherheit spüren. Ein Nutzer beschreibt, wie seine Kinder durch die ständigen Geldsorgen der Eltern verunsichert sind. Offene Gespräche helfen, die Ängste der Kinder zu lindern. Laut einer Quelle sind solche Gespräche entscheidend, um die emotionale Stabilität der Kinder zu fördern.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind ebenfalls wichtig. Kinder haften nicht für die Schulden der Eltern. Dennoch können Unterhaltsansprüche bestehen, die auch während einer Privatinsolvenz gelten. Nutzer berichten, dass es oft schwer ist, Unterhalt einzufordern. Ein Elternteil in Insolvenz hat Schwierigkeiten, die Zahlungen aufrechtzuerhalten. Ein Nutzer beschreibt, dass das Jugendamt in seinem Fall den Mindestunterhalt forderte, er aber selbst kein Geld hat, um diesen zu zahlen. Das führt zu einer weiteren Belastung für die Familie. In Diskussionen wird deutlich, dass viele in ähnlichen Situationen stecken.
Die finanzielle Unsicherheit hat auch Einfluss auf den Alltag. Eltern berichten von Einschränkungen in der Lebensführung. Freizeitaktivitäten sind oft nicht möglich. Ein Nutzer schildert, dass Ausflüge oder Hobbys der Kinder häufig aus finanziellen Gründen abgesagt werden müssen. Dies führt zu Frustration und einem angespannten Familienklima.
Eine positive Erkenntnis: Viele Nutzer finden Unterstützung in Online-Communities. Der Austausch mit anderen Betroffenen hilft, Lösungen zu finden und den Druck zu mindern. Gruppen bieten Raum für Rat und teilen Erfahrungen, die in schwierigen Zeiten entlasten können.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Privatinsolvenz in der Familie viele Herausforderungen mit sich bringt. Die emotionalen und finanziellen Belastungen sind hoch. Dennoch ist es wichtig, offen über die Situation zu sprechen und Unterstützung zu suchen.
FAQ: Privatinsolvenz in der Familie und Geburt eines Kindes
Müssen Kinder oder Ehepartner für die Schulden im Rahmen der Privatinsolvenz mithaften?
Grundsätzlich haften Kinder oder Ehepartner nicht für die Schulden einer in Insolvenz geratenen Person, es sei denn, sie haben Verträge ausdrücklich mitunterschrieben oder sich als Bürge verpflichtet. Gemeinsames Vermögen muss allerdings klar getrennt und nachweisbar sein, um Missverständnisse zu vermeiden.
Wird das Kindergeld bei Privatinsolvenz gepfändet?
Kindergeld ist unpfändbar und steht ausschließlich dem Kind zu. Es darf rechtlich nicht zur Schuldentilgung verwendet werden. Damit der Schutz auch bei einer Kontopfändung greift, sollte das Kindergeld eindeutig nachgewiesen und – wenn möglich – ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) eingerichtet werden.
Wie wirkt sich die Geburt eines Kindes auf den Pfändungsfreibetrag aus?
Mit jedem unterhaltsberechtigten Kind erhöht sich der Pfändungsfreibetrag spürbar. So bleibt dem Schuldner mehr Einkommen zum Lebensunterhalt. Ab 1. Juli 2024 liegt der Freibetrag mit einem Kind bei 2.059,99 € monatlich. Für jedes weitere unterhaltsberechtigte Kind steigt der Betrag zusätzlich an.
Müssen Eltern während der Insolvenz ihre Erwerbsobliegenheit trotz Kinderbetreuung erfüllen?
Die Pflicht zur Arbeitsaufnahme (Erwerbsobliegenheit) wird individuell geprüft. Wer sich um kleine Kinder kümmert oder alleinerziehend ist, kann davon ganz oder teilweise befreit werden. Dafür müssen Betreuungsbedarf und Lebensumstände nachgewiesen werden – etwa durch Kita-Bescheinigungen oder ein Attest.
Welche Nachweise benötigen Eltern, um erhöhte Freibeträge und Schutz für das Kind zu erhalten?
Eltern sollten Geburtsurkunden, Sorgerechtsnachweise, Unterhalts- und Kindergeldbescheinigungen sowie Nachweise zur Betreuungssituation (z.B. Kindergartenzeiten) bereithalten. Für das Pfändungsschutzkonto müssen diese Nachweise der Bank vorgelegt werden, damit der erhöhte Freibetrag sofort berücksichtigt wird.