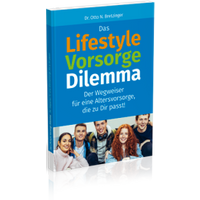Inhaltsverzeichnis:
Voraussetzungen für die Privatinsolvenz bei Arbeitsunfähigkeit
Voraussetzungen für die Privatinsolvenz bei Arbeitsunfähigkeit
Arbeitsunfähigkeit ist kein Hindernis, um eine Privatinsolvenz zu beantragen – aber es gibt ein paar entscheidende Details, die Betroffene kennen sollten. Die wichtigste Voraussetzung: Sie müssen tatsächlich zahlungsunfähig oder zumindest von Zahlungsunfähigkeit bedroht sein. Das ist oft bei längerer Krankheit oder nach einem Unfall der Fall, wenn das Einkommen plötzlich wegbrechen oder dauerhaft unter das Existenzminimum rutschen kann.
Wer arbeitsunfähig ist, muss für das Insolvenzgericht nachvollziehbar belegen, dass er oder sie nicht mehr in der Lage ist, durch Arbeit ein pfändbares Einkommen zu erzielen. Das gelingt am besten mit aktuellen ärztlichen Attesten oder, bei dauerhafter Erwerbsminderung, mit einem Rentenbescheid. Je genauer und nachvollziehbarer diese Nachweise sind, desto reibungsloser läuft das Verfahren an.
Ein wichtiger Punkt, der häufig übersehen wird: Auch bei Arbeitsunfähigkeit muss zunächst eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern versucht werden. Das ist gesetzlich vorgeschrieben und wird oft über eine anerkannte Schuldnerberatungsstelle abgewickelt. Erst wenn dieser Versuch scheitert, kann der eigentliche Insolvenzantrag gestellt werden.
Außerdem sollten Sie wissen: Das Insolvenzverfahren steht auch Menschen offen, die Sozialleistungen wie Krankengeld, Erwerbsminderungsrente oder Bürgergeld beziehen. Entscheidend ist allein, dass die Überschuldung nicht aus unternehmerischer Tätigkeit stammt – dann käme das Regelinsolvenzverfahren zum Tragen.
Zusammengefasst: Wer durch Krankheit oder Unfall arbeitsunfähig ist, kann Privatinsolvenz beantragen, sofern die Zahlungsunfähigkeit belegt und die gesetzlich geforderten Schritte (insbesondere der Einigungsversuch) eingehalten werden. Spezielle ärztliche Nachweise und die richtige Dokumentation sind dabei der Schlüssel, um das Verfahren erfolgreich zu starten.
So wirkt sich die Arbeitsunfähigkeit auf das Insolvenzverfahren aus
So wirkt sich die Arbeitsunfähigkeit auf das Insolvenzverfahren aus
Arbeitsunfähigkeit verändert den Verlauf einer Privatinsolvenz in mehreren Punkten – manchmal subtil, manchmal sehr deutlich. Zunächst einmal: Das pfändbare Einkommen fällt oft geringer aus oder bleibt sogar ganz aus, weil Lohnersatzleistungen wie Krankengeld oder Erwerbsminderungsrente häufig unterhalb der Pfändungsfreigrenze liegen. Für viele Betroffene bedeutet das, dass sie während des gesamten Verfahrens keine Zahlungen an den Treuhänder leisten müssen. Das Insolvenzverfahren läuft dennoch weiter, ohne dass daraus ein Nachteil entsteht.
Ein weiterer Effekt: Die sogenannte Erwerbsobliegenheit – also die Pflicht, sich um eine Arbeit zu bemühen – wird bei nachgewiesener Arbeitsunfähigkeit ausgesetzt. Das entlastet die Betroffenen, denn sie müssen keine Bewerbungsbemühungen dokumentieren oder Nachweise über Jobsuche führen. Das gilt aber wirklich nur, wenn die Arbeitsunfähigkeit lückenlos belegt ist und regelmäßig aktualisiert wird.
Spannend ist auch, dass sich die Kommunikation mit dem Insolvenzverwalter verändert. Es rückt weniger die Einkommensprüfung in den Vordergrund, sondern vielmehr die Überprüfung der gesundheitlichen Situation. Der Insolvenzverwalter kann zum Beispiel Nachfragen stellen oder neue Atteste verlangen, falls Zweifel an der Dauer oder Schwere der Arbeitsunfähigkeit bestehen.
Zu beachten ist außerdem: Wer während des Verfahrens wieder arbeitsfähig wird und Einkommen erzielt, muss dies umgehend mitteilen. Dann greifen wieder die üblichen Pflichten, insbesondere die Abführung des pfändbaren Anteils. Eine Änderung der gesundheitlichen Situation kann also das Verfahren dynamisch beeinflussen.
Insgesamt bringt Arbeitsunfähigkeit Erleichterungen bei den Mitwirkungspflichten, aber auch die Notwendigkeit, den eigenen Gesundheitsstatus transparent und lückenlos zu dokumentieren. Wer das versäumt, riskiert im schlimmsten Fall die Versagung der Restschuldbefreiung.
Vor- und Nachteile der Privatinsolvenz bei Arbeitsunfähigkeit im Überblick
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Arbeitsunfähigkeit blockiert die Privatinsolvenz nicht – Betroffene können das Verfahren durchlaufen. | Umfangreiche Nachweispflichten: Ärztliche Atteste und regelmäßige Updates an den Insolvenzverwalter sind erforderlich. |
| Keine Erwerbsobliegenheit bei nachgewiesener vollständiger Arbeitsunfähigkeit – man muss keine Arbeit suchen oder Bewerbungen schreiben. | Bei fehlenden, verspäteten oder lückenhaften Nachweisen droht die Versagung der Restschuldbefreiung. |
| Meist kein pfändbares Einkommen (z.B. bei Bezug von Erwerbsminderungsrente oder Bürgergeld), sodass keine Zahlungen an den Treuhänder geleistet werden müssen. | Sobald die Arbeitsfähigkeit zurückkehrt oder sich die Einkommenssituation verbessert, muss dies sofort gemeldet werden – sonst drohen Nachteile. |
| Auch bei dauerhafter Arbeitsunfähigkeit ist eine Restschuldbefreiung nach drei Jahren möglich. | Ständiger Dokumentationsaufwand wegen laufender Überprüfung durch den Insolvenzverwalter. |
| Sozialleistungen wie Krankengeld oder Rente schließen das Verfahren nicht aus. | Risiko von Rückforderungen bei nicht mitgeteilten Änderungen bei Leistungen oder Einkommen. |
Erwerbsobliegenheit trotz Krankheit: Was gilt, was entfällt?
Erwerbsobliegenheit trotz Krankheit: Was gilt, was entfällt?
Die Erwerbsobliegenheit ist im Insolvenzverfahren ein echtes Kernthema, doch bei Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit verschieben sich die Spielregeln spürbar. Entscheidend ist: Nicht jede Krankheit führt automatisch dazu, dass die Erwerbsobliegenheit komplett entfällt. Vielmehr wird ganz genau hingeschaut, wie stark die gesundheitlichen Einschränkungen tatsächlich sind.
- Teilweise Arbeitsfähigkeit: Wer zwar krank, aber nicht vollständig arbeitsunfähig ist, muss sich im Rahmen seiner Möglichkeiten weiterhin um eine Beschäftigung bemühen. Das bedeutet zum Beispiel: Bei einer eingeschränkten Belastbarkeit könnten auch Teilzeitstellen oder Tätigkeiten mit geringerer körperlicher Beanspruchung infrage kommen.
- Attestierte vollständige Arbeitsunfähigkeit: Liegt ein ärztliches Attest vor, das eine vollständige Arbeitsunfähigkeit für einen bestimmten Zeitraum oder dauerhaft bestätigt, entfällt die Erwerbsobliegenheit für diesen Zeitraum. Die Bescheinigung muss regelmäßig erneuert und dem Insolvenzverwalter vorgelegt werden.
- Psychische Erkrankungen: Gerade bei psychischen Leiden wird häufig besonders kritisch geprüft, ob und in welchem Umfang eine Arbeitsaufnahme zumutbar wäre. Hier sind ausführliche fachärztliche Gutachten oft unverzichtbar, um Missverständnisse oder Zweifel auszuräumen.
- Veränderung des Gesundheitszustands: Wird die gesundheitliche Situation besser, lebt die Erwerbsobliegenheit sofort wieder auf. Das muss dem Insolvenzverwalter unverzüglich gemeldet werden, sonst drohen empfindliche Konsequenzen.
- Individuelle Zumutbarkeit: Manchmal gibt es Grauzonen – etwa bei chronischen Erkrankungen, die mal mehr, mal weniger einschränken. In solchen Fällen kann die Erwerbsobliegenheit anteilig gelten. Die Anforderungen richten sich dann nach dem, was realistisch leistbar ist.
Unterm Strich: Die Erwerbsobliegenheit ist bei Krankheit keineswegs pauschal aufgehoben. Es zählt immer der Einzelfall – und wie lückenlos die gesundheitlichen Einschränkungen nachgewiesen werden. Wer hier transparent bleibt und Veränderungen rechtzeitig meldet, ist auf der sicheren Seite.
Nachweise und Pflichten während der Privatinsolvenz bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit
Nachweise und Pflichten während der Privatinsolvenz bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit
Im laufenden Insolvenzverfahren ist die Dokumentation der eigenen Situation das A und O. Wer wegen Krankheit oder Unfall arbeitsunfähig ist, muss dem Insolvenzverwalter regelmäßig aussagekräftige Nachweise vorlegen. Das können nicht nur einfache Krankschreibungen sein, sondern auch ausführliche ärztliche Stellungnahmen, die Art, Dauer und voraussichtliche Entwicklung der Erkrankung konkret beschreiben. Besonders wichtig: Die Nachweise sollten immer aktuell sein und dürfen keine Lücken aufweisen.
- Fristen beachten: Atteste und Gutachten müssen meist in festgelegten Abständen eingereicht werden. Verpasst man diese Fristen, kann das schnell als fehlende Mitwirkung gewertet werden.
- Mitteilungspflicht bei Veränderungen: Jede Verbesserung oder Verschlechterung des Gesundheitszustands ist unverzüglich mitzuteilen. Auch geplante Reha-Maßnahmen oder Umschulungen sollten gemeldet werden, da sie Einfluss auf die Erwerbsfähigkeit haben könnten.
- Zusätzliche Nachweise: In manchen Fällen verlangt der Insolvenzverwalter ergänzende Unterlagen, etwa Berichte von Fachärzten, Reha-Entlassungsberichte oder sogar sozialmedizinische Gutachten. Wer hier zügig liefert, vermeidet unnötige Verzögerungen.
- Kooperation mit Behörden: Falls Leistungen wie Erwerbsminderungsrente oder Krankengeld bezogen werden, ist die Zusammenarbeit mit der Rentenversicherung oder Krankenkasse ebenfalls nachzuweisen. Hier reicht oft ein aktueller Leistungsbescheid.
Ein kleiner, aber nicht unwichtiger Punkt: Wer sich um die Nachweise nicht kümmert oder nur lückenhaft informiert, riskiert, dass das Gericht Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit bekommt. Das kann im schlimmsten Fall zur Versagung der Restschuldbefreiung führen. Also lieber einmal mehr nachhaken und alles sauber dokumentieren – das zahlt sich am Ende aus.
Beispiel: Ein Insolvenzverfahren bei dauerhafter Arbeitsunfähigkeit
Beispiel: Ein Insolvenzverfahren bei dauerhafter Arbeitsunfähigkeit
Stellen wir uns vor, eine Person erhält nach einem schweren Unfall die volle Erwerbsminderungsrente auf unbestimmte Zeit. Die Schulden sind hoch, das Einkommen besteht ausschließlich aus dieser Rente, die unterhalb der Pfändungsfreigrenze liegt. Was passiert nun im Insolvenzverfahren?
- Zu Beginn wird der Rentenbescheid als Beleg für die dauerhafte Arbeitsunfähigkeit eingereicht. Das Gericht erkennt damit an, dass keine Erwerbsobliegenheit besteht.
- Da die Rente unter der Pfändungsgrenze liegt, fließt während der gesamten Wohlverhaltensphase kein Geld an die Gläubiger. Trotzdem läuft das Verfahren ganz normal weiter.
- Der Insolvenzverwalter prüft regelmäßig, ob sich die Einkommenssituation oder der Gesundheitszustand verändert. Sollte die Rente steigen oder eine Nebentätigkeit aufgenommen werden, muss dies gemeldet werden.
- Während des gesamten Verfahrens bleibt die Pflicht, Veränderungen unverzüglich mitzuteilen. Das betrifft auch etwaige Einmalzahlungen, wie zum Beispiel eine Nachzahlung der Rentenversicherung.
- Nach Ablauf der dreijährigen Wohlverhaltensphase wird die Restschuldbefreiung erteilt, sofern alle Mitwirkungspflichten erfüllt wurden. Die Schulden sind damit endgültig erledigt – unabhängig davon, dass kein pfändbares Einkommen vorhanden war.
Dieses Beispiel zeigt: Auch bei dauerhafter Arbeitsunfähigkeit ist eine vollständige Entschuldung durch Privatinsolvenz möglich, solange die gesetzlichen Vorgaben konsequent eingehalten werden.
Risiken: Folgen bei Verstößen gegen die Obliegenheiten
Risiken: Folgen bei Verstößen gegen die Obliegenheiten
Werden die im Insolvenzverfahren geltenden Obliegenheiten verletzt, drohen spürbare Konsequenzen, die oft unterschätzt werden. Besonders tückisch: Manche Fehler fallen erst spät auf, wirken sich dann aber umso gravierender aus.
- Versagung der Restschuldbefreiung: Das Gericht kann die Schuldenbefreiung komplett verweigern, wenn Nachweise fehlen, Veränderungen verschwiegen oder falsche Angaben gemacht werden. Damit bleiben sämtliche Verbindlichkeiten bestehen – ein echter Albtraum für Betroffene.
- Verlängerung der Wohlverhaltensphase: In manchen Fällen wird das Verfahren nicht beendet, sondern verlängert. Das bedeutet: weitere Jahre unter strengen Auflagen, ohne Aussicht auf einen schnellen Neuanfang.
- Rückforderungen und Schadenersatz: Werden beispielsweise unzulässige Zahlungen verschwiegen oder Vermögenswerte verheimlicht, kann der Insolvenzverwalter Rückforderungen geltend machen. In schweren Fällen droht sogar die Strafanzeige wegen Insolvenzverschleppung oder Betrugs.
- Verlust von Sozialleistungen: Bei nicht gemeldeten Einkommensänderungen können auch Behörden Leistungen zurückfordern. Das betrifft zum Beispiel zu Unrecht bezogenes Bürgergeld oder Wohngeld.
- Negative Auswirkungen auf künftige Verfahren: Wer einmal durch Versäumnisse auffällt, muss bei einem erneuten Insolvenzantrag mit besonders strenger Prüfung rechnen. Das kann die Chancen auf einen erfolgreichen zweiten Versuch erheblich schmälern.
Ein einziger Fehler kann also das gesamte Verfahren kippen. Wer unsicher ist, sollte frühzeitig fachkundige Hilfe suchen, um diese Risiken gar nicht erst entstehen zu lassen.
Tipps für Betroffene: So vermeiden Sie typische Fehler im Verfahren
Tipps für Betroffene: So vermeiden Sie typische Fehler im Verfahren
- Reichen Sie Nachweise nicht nur auf Nachfrage ein, sondern proaktiv und in regelmäßigen Abständen. So signalisieren Sie Zuverlässigkeit und ersparen sich lästige Rückfragen vom Insolvenzverwalter.
- Halten Sie ein einfaches, aber lückenloses Tagebuch über Arztbesuche, Therapien und Kontakte mit Behörden. Bei Rückfragen können Sie so sofort alle relevanten Daten vorlegen – das macht Eindruck und schafft Vertrauen.
- Nutzen Sie digitale Tools oder Apps, um Fristen und Termine zu überwachen. Gerade bei längeren Verfahren kann ein verpasster Stichtag schnell zu Problemen führen.
- Bleiben Sie bei Rückfragen immer erreichbar. Eine verpasste Post vom Gericht oder Insolvenzverwalter kann gravierende Folgen haben – richten Sie ggf. einen Nachsendeauftrag ein, falls Sie umziehen.
- Holen Sie sich frühzeitig Unterstützung von einer anerkannten Schuldnerberatung oder einem Fachanwalt, wenn Unsicherheiten auftauchen. Externe Beratung kann nicht nur Fehler verhindern, sondern oft auch den Ablauf beschleunigen.
- Vermeiden Sie es, „auf eigene Faust“ mit Gläubigern zu verhandeln, sobald das Verfahren läuft. Solche Absprachen können als Benachteiligung anderer Gläubiger gewertet werden und das Verfahren gefährden.
- Informieren Sie alle beteiligten Stellen sofort über jede Änderung Ihrer Kontaktdaten. Ein veralteter Adressdatensatz ist ein häufiger Grund für Missverständnisse und Fristversäumnisse.
Wer diese Hinweise beherzigt, hat beste Chancen, das Verfahren ohne böse Überraschungen und mit maximaler Klarheit zu durchlaufen.
Wann ist eine professionelle Beratung besonders wichtig?
Wann ist eine professionelle Beratung besonders wichtig?
Es gibt Situationen, in denen fachkundige Unterstützung unverzichtbar wird. Gerade bei komplexen gesundheitlichen Verläufen oder wenn Unsicherheiten im Umgang mit Behörden auftreten, ist professionelle Beratung Gold wert. Sie hilft, Stolperfallen zu erkennen, bevor sie zum Problem werden, und verschafft einen Überblick über alle rechtlichen Möglichkeiten.
- Unklare Prognosen: Wenn die Dauer der Arbeitsunfähigkeit nicht eindeutig absehbar ist, können Experten helfen, realistische Einschätzungen für das Verfahren zu liefern und die richtige Strategie zu wählen.
- Mehrfache Einkommensquellen: Wer neben einer Rente noch Nebeneinkünfte, Unterhaltszahlungen oder Einmalzahlungen erhält, profitiert von einer Beratung, um steuerliche und insolvenzrechtliche Auswirkungen korrekt einzuschätzen.
- Streit mit Gläubigern oder dem Insolvenzverwalter: Bei Meinungsverschiedenheiten zu Nachweisen, Pflichten oder Zahlungen ist rechtlicher Beistand oft entscheidend, um die eigenen Interessen zu wahren.
- Besondere Lebenslagen: Kommen Pflegeverantwortung, ein laufendes Familienverfahren oder internationale Aspekte hinzu, wird die Sachlage schnell unübersichtlich. Hier ist eine individuelle Beratung meist alternativlos.
- Vorbereitung auf das Verfahren: Schon vor dem Insolvenzantrag können Beratungsstellen helfen, Unterlagen zu ordnen, Fristen zu planen und eine realistische Einschätzung der Erfolgsaussichten zu bekommen.
Eine frühzeitige, professionelle Beratung sorgt nicht nur für Sicherheit, sondern oft auch für eine deutliche Entlastung im Alltag – und das ist in einer ohnehin belastenden Lebensphase ein unschätzbarer Vorteil.
Nützliche Links zum Thema
- Muss ich arbeiten während einem privaten Insolvenzverfahren?
- Privatinsolvenz: Was habe ich zu beachten? - DER SPIEGEL
- Schuldenfalle wegen Krankheit - Insolvenzrecht
Produkte zum Artikel

9.95 EUR* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

59.95 EUR* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.
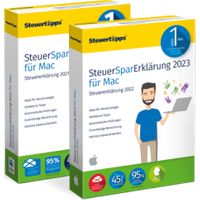
59.95 EUR* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.

24.99 EUR* * inklusive 0% MwSt. / Preis kann abweichen, es gilt der Preis auf dem Onlineshop des Anbieters.
Erfahrungen und Meinungen
Nutzer berichten von verschiedenen Herausforderungen bei der Privatinsolvenz aufgrund von Arbeitsunfähigkeit. Ein häufiges Problem: die finanzielle Belastung durch Krankheitskosten und fehlendes Einkommen. Viele Anwender sind durch längere Krankheiten in eine finanzielle Schieflage geraten. Oft reicht das Krankengeld nicht aus, um die laufenden Kosten zu decken.
Ein Nutzer beschreibt seine Situation nach einem Jobverlust wegen psychischer Erkrankungen. Er lebte zunächst schuldenfrei, doch nach seinem Klinikaufenthalt häuften sich die Rechnungen. Die Miete für ein WG-Zimmer und die Abschlagszahlungen für Gas wurden nicht rechtzeitig abgebucht. In der Folge stiegen die Schulden auf über 2.900 Euro. Solche Erfahrungen zeigen, wie schnell es zu einer Überschuldung kommen kann, wenn das Einkommen wegfällt.
Ein weiteres häufiges Problem: die Unsicherheit über die rechtlichen Schritte. Anwender sind oft überfordert, wenn es darum geht, die notwendigen Schritte zur Privatinsolvenz einzuleiten. Viele wissen nicht, welche Unterlagen erforderlich sind und wie lange der Prozess dauert. Nutzer in Foren wie Schuldner Community teilen ihre Ängste und Unsicherheiten.
Ein typisches Anliegen: die Frage, ob das Krankengeld als Einkommen zählt. Viele Anwender sind sich unsicher, ob sie die Voraussetzung der Zahlungsunfähigkeit erfüllen. Klar ist: Wer dauerhaft nicht in der Lage ist, seine Schulden zu tilgen, hat gute Chancen auf eine Privatinsolvenz. Ein Nutzer erwähnt, dass das Krankengeld in seinem Fall als Einkommen gewertet wurde, was den Prozess erleichtert hat.
Ein weiterer Nutzer schildert seine positive Erfahrung mit einer Beratung. Er holte sich Hilfe bei einer Schuldnerberatung und erhielt wertvolle Informationen. Die Unterstützung half ihm, einen klaren Plan zu entwickeln. Viele Anwender empfehlen, frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen. So lassen sich die finanziellen Probleme oft besser bewältigen.
Die häufigste Empfehlung in den Foren: schnell handeln. Nutzer berichten, dass es wichtig ist, sich nicht zu scheuen, Hilfe zu suchen. Oft gibt es Möglichkeiten, Schulden zu reduzieren oder Zahlungspläne zu erstellen. Ein Nutzer beschreibt, dass er seine Gläubiger kontaktieren konnte, um Zahlungsaufschübe zu vereinbaren.
Insgesamt zeigt sich, dass die Erfahrungen von Nutzern variieren. Während einige den Prozess als belastend empfinden, berichten andere von positiven Wendungen. Die Unterstützung durch Fachleute wird von vielen als entscheidend angesehen. Für Betroffene ist es wichtig, sich rechtzeitig zu informieren und Hilfe zu suchen, um den Weg aus der Schuldenfalle zu finden.
FAQ: Privatinsolvenz und Arbeitsunfähigkeit – Ihre wichtigsten Fragen beantwortet
Kann ich trotz Arbeitsunfähigkeit Privatinsolvenz anmelden?
Ja, eine Arbeitsunfähigkeit ist kein Hindernis für die Anmeldung einer Privatinsolvenz. Voraussetzung ist jedoch, dass Sie zahlungsunfähig sind oder eine Zahlungsunfähigkeit droht. Wichtig ist die lückenlose Dokumentation der Arbeitsunfähigkeit durch aktuelle ärztliche Atteste oder Rentenbescheide.
Welche Nachweise muss ich bei Krankheit im Insolvenzverfahren erbringen?
Sie müssen dem Insolvenzverwalter regelmäßig ärztliche Atteste oder ähnliche Nachweise vorlegen, aus denen Art, Dauer und voraussichtliche Entwicklung der Arbeitsunfähigkeit hervorgehen. Die Unterlagen sollten immer aktuell sein und dürfen keine Lücken aufweisen.
Muss ich während der Privatinsolvenz trotz Arbeitsunfähigkeit eine Arbeit suchen?
Bei vollständiger und nachgewiesener Arbeitsunfähigkeit entfällt die Pflicht zur Arbeitssuche. Die Erwerbsobliegenheit besteht nicht, wenn Sie dies lückenlos durch Atteste nachweisen können. Verbessert sich Ihr Gesundheitszustand, lebt die Pflicht zur Arbeitssuche allerdings wieder auf.
Was passiert, wenn ich meinen Mitwirkungspflichten während der Privatinsolvenz nicht nachkomme?
Wer seinen Nachweispflichten nicht nachkommt, wichtige Fristen versäumt oder Änderungen nicht meldet, riskiert die Versagung der Restschuldbefreiung. Das bedeutet, die Schulden bleiben bestehen und die Mühen des Verfahrens waren umsonst.
Gibt es Besonderheiten beim Bezug von Sozialleistungen während der Privatinsolvenz?
Sozialleistungen wie Krankengeld, Erwerbsminderungsrente oder Bürgergeld schließen eine Privatinsolvenz nicht aus. Meist bleibt das Einkommen unter der Pfändungsfreigrenze, sodass keine Zahlungen an Gläubiger erfolgen. Wichtig ist, dass Sie Veränderungen bei den Leistungen oder Ihrer Gesundheit zeitnah melden.